Fantasy Filmfest 2011 – Tag 4
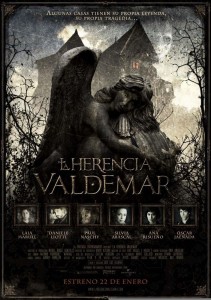 |
 |
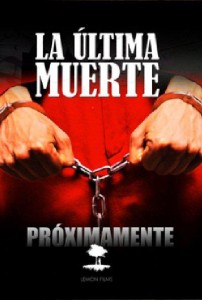 |
 |
 |
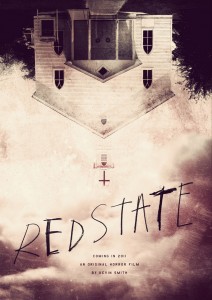 |
| The Valdemar Legacy | Suicide Room | The Last Death | Urban Explorer | Cowboys & Aliens | Red State |
The Valdemar Legacy / La herencia Valdemar 
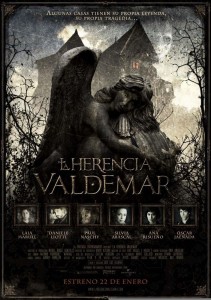 Trotz des Titels, trotz des Ursprungslands Spanien, trotz Altstar Paul Naschy in einer Nebenrolle: The Valdemar Legacy hat nichts zu tun mit der legendären Werwolf-Serie, in der Naschy den verfluchten Edelmann Waldemar Daninsky gibt. Der Film dürfte stattdessen der erste dieser Größenordnung sein, der dem Universum des H.P. Lovecraft auf so viele Weisen gerecht wird. Schon der kunstvoll gemachte Vorspann bereitet auf eine Schauermär vor, in der atmosphärisch und thematisch alles in die Waagschale geworfen wird, was der Gothic Horror zu bieten hat: knarzige Herrenhäuser, Séancen, Geisterfotografie, Satanismus, wiedererweckte Leichen, Wahnsinn, Kultisten, seltsame Rituale und zeitgenössische Stars wie Aleister Crowley, Lizzie Borden und Bram Stoker. Ein Fest für Cthulhu-Fans und Liebhaber altmodischen Gruselhorrors.
Trotz des Titels, trotz des Ursprungslands Spanien, trotz Altstar Paul Naschy in einer Nebenrolle: The Valdemar Legacy hat nichts zu tun mit der legendären Werwolf-Serie, in der Naschy den verfluchten Edelmann Waldemar Daninsky gibt. Der Film dürfte stattdessen der erste dieser Größenordnung sein, der dem Universum des H.P. Lovecraft auf so viele Weisen gerecht wird. Schon der kunstvoll gemachte Vorspann bereitet auf eine Schauermär vor, in der atmosphärisch und thematisch alles in die Waagschale geworfen wird, was der Gothic Horror zu bieten hat: knarzige Herrenhäuser, Séancen, Geisterfotografie, Satanismus, wiedererweckte Leichen, Wahnsinn, Kultisten, seltsame Rituale und zeitgenössische Stars wie Aleister Crowley, Lizzie Borden und Bram Stoker. Ein Fest für Cthulhu-Fans und Liebhaber altmodischen Gruselhorrors.
Da macht es auch nichts, dass der Film zwischen drei Hauptfiguren und zwei Zeitebenen hin und her springt, die jeweils nichts oder nur lose miteinander zu tun haben, schließlich ist all das nur das Setup für den zweiten Teil – das als Warnung: The Valdemar Legacy endet mit einem Cliffhanger. Nur den ersten Teil zu sehen, bringt also nichts. The Good.
Suicide Room / Sala samobójców 
 Dominik merkt kurz vor der Matura, dass er sich für Jungs interessiert. Seine Umgebung reagiert darauf mit Hohn und Bloßstellung (wir befinden uns immerhin in Polen, wo Homosexualität noch bis in die Neunziger offiziell als Krankheit galt), und auch seine karrieregeilen Eltern sind ihm keine Hilfe. Der Junge verliert sich daraufhin in einer schweren Depression und zieht sich immer weiter zurück, erst in sein Zimmer, dann ins Internet, wo er andere Kiddies kennenlernt, die sich umzubringen planen.
Dominik merkt kurz vor der Matura, dass er sich für Jungs interessiert. Seine Umgebung reagiert darauf mit Hohn und Bloßstellung (wir befinden uns immerhin in Polen, wo Homosexualität noch bis in die Neunziger offiziell als Krankheit galt), und auch seine karrieregeilen Eltern sind ihm keine Hilfe. Der Junge verliert sich daraufhin in einer schweren Depression und zieht sich immer weiter zurück, erst in sein Zimmer, dann ins Internet, wo er andere Kiddies kennenlernt, die sich umzubringen planen.
Emo ist SO nuller Jahre. Super-out. Bzw. deswegen wahrscheinlich wieder in, oder was weiß ich. Suicide Room ist jedenfalls ein Emo-Drama, das alles auffährt, was man so mit dieser Jugendkultur verbindet, von Selbsthass und Weltschmerz bis zu romatischem Kitsch und schwarz lackierten Fingernägeln. Natürlich ist das nötig. Ein Film muss verdichten, wenn er in 90 Minuten möglichst viel Leben stopfen will. Das führt in Suicide Room allerdings dazu, dass man gelegentlich das Gefühl hat, eine sehr verheulte Soap Opera zu sehen. Wie der Film wirklich jedes Emo-Klischee abhakt – das nagt irgendwann an den Grenzen der Glaubwürdigkeit. Auch die Figuren der Eltern kauft man nicht. Dass sie hilflos sind, nie gelernt haben, sich mit ihrem Sohn zu beschäftigen: gut. Aber wenn ich merke, dass mein Kind eindeutig Internet-süchtig ist, dann komme ich nicht erst zwanzig Minuten vor Filmende mal auf die Idee, den Netzstecker zu ziehen.
Was man Suicide Room zugute halten muss, ist, dass er die Emo-Kultur ernst nimmt, dass er für die Szenen, die sich online abspielen, bessere Bilder findet als der ähnlich gelagerte Chatroom aus dem letzten Jahr, und dass er das Verhalten von Online-Communities sehr präzise wiedergibt. Erwähnen muss man auch Jakub Gierszal, der als Dominik eine hervorragende Vorstellung abliefert. Was man Suicide Room vorwerfen muss, ist, dass er dazu geeignet ist, das seit jeher zwischen Lächerlichkeit und Bedrohung schwankende Image von Emos in der Öffentlichkeit und vor allem in den Augen besorgter Eltern weiter zu beschädigen, denn hier sind alle Emos potentielle Amokläufer, allesamt mit der Planung ihres Selbstmords beschäftigt und natürlich depressiv. Und hier wird dann klar, für wen der Film gedacht ist: eben nicht für die breite Masse, die den Film in den falschen Hals bekommen würde, sondern quasi von Fans für Fans, für ein Publikum, das genauso hysterisch, selbstmitleidig und egozentrisch ist, wie die Hauptfigur. Teenager halt. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, bekommt mit Suicide Room zumindest seinen ultimativen Herz-Schmerz-Film. The Durchschnitt.
The Last Death / La última muerte 
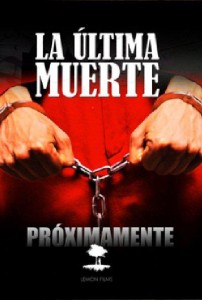 Ein Mann verbringt den Abend in einem Ferienhaus im Wald und findet vor der Hütte einen Verletzten, der sein Gedächtnis verloren hat. Mehr noch: der Fremde ist wirklich ein solcher, denn er taucht weltweit in keiner Datenbank auf – es ist, als würde er nicht existieren.
Ein Mann verbringt den Abend in einem Ferienhaus im Wald und findet vor der Hütte einen Verletzten, der sein Gedächtnis verloren hat. Mehr noch: der Fremde ist wirklich ein solcher, denn er taucht weltweit in keiner Datenbank auf – es ist, als würde er nicht existieren.
The Last Death ist ein Science Fiction, aber nur so weit, wie es unbedingt nötig ist, um die Handlung möglich und die nahe Zukunft in der er spielt glaubwürdig zu machen (was dazu führt, dass mir zumindest erst nach gut zwanzig Minuten aufgefallen ist, dass der Film nicht in unserer Realität stattfindet). Im Wesentlichen aber präsentiert er eine Detektivgeschichte, in der der Held den Hintergrund des geheimnisvollen Unbekannten recherchiert und sich Schritt für Schritt der Auflösung des Rätsels nähert. Bis es dann soweit ist, wird gedieggen Spannung aufgebaut. Wenn die Katze dann aber aus dem Sack ist, hat The Last Death auf einmal mehrere Probleme: zum einen erklärt er alles doppelt und dreifach und vermittelt den Eindruck, er würde sein Publikum für blöde halten. Zum anderen lässt einen die Auflösung des Rätsels kalt, weil dessen moralische Dimensionen zuvor nicht verhandelt wurden. Auch das persönliche Drama der Hauptfigur bleibt blass zugunsten der Geschichte des Amnesiepatienten, der den deutlich interessanteren Protagonisten abgegeben hätte. Nach der Hälfte, maximal zwei Dritteln ist die Luft raus.
Im Rahmen dessen, was er erzählen will, ist The Last Death ein handwerklich nicht schlecht gemachter Film. Dass unterm Strich dennoch nur Durchschnitt bleibt, liegt daran, dass die Story in dieser Form einfach nicht mehr hergibt. The Durchschnitt.
Urban Explorer 
 Unter Berlin existieren tausende Schächte, die teils seit sechzig Jahren nicht mehr betreten wurden. Es gibt Leute, die in dieses Labyrinth hinunterklettern und auf Entdeckungstour gehen, wie auch die Touri-Gruppe aus Urban Explorer, die sich eines Nachts zu einer illegalen Führung zusammenfindet. Was als historiengetränktes Abenteuer beginnt, wird alsbald zum Horrortrip, denn die jungen Leute sind in den Tunneln nicht allein.
Unter Berlin existieren tausende Schächte, die teils seit sechzig Jahren nicht mehr betreten wurden. Es gibt Leute, die in dieses Labyrinth hinunterklettern und auf Entdeckungstour gehen, wie auch die Touri-Gruppe aus Urban Explorer, die sich eines Nachts zu einer illegalen Führung zusammenfindet. Was als historiengetränktes Abenteuer beginnt, wird alsbald zum Horrortrip, denn die jungen Leute sind in den Tunneln nicht allein.
Der Look, die Kamera, die Atmosphäre – das alles ist gewissenhaft von den US-Vorbildern kopiert. Leider übernehmen die Macher von Urban Explorer auch deren notorische Schwäche: hier wie dort strotzt das Drehbuch vor Unlogik, Unglaubwürdigkeiten und depperten Dialogen, und nach gutem Beginn macht die Geschichte auf halber Strecke krächzend schlapp, woraufhin alle Figuren sich nur noch wie schwachsinnig verhalten und die Spannung kopfschüttelnd den Saal verlässt. Was Urban Explorer dennoch reizvoll macht, ist der Umstand, dass er laut Regisseur Andy Fetscher zu etwa 80 Prozent an Originalschauplätzen unter Tage gedreht wurde. Was diesen Reiz wieder entwertet ist, dass der Zuschauer nicht weiß, welche Szenen das sind. Bleibt die Tatsache, dass man hier mal einen waschechten deutschen Horrorfilm zu sehen bekommt, der weder Amateurkiddie-Rotz noch kunstbeflissener Hochschul- oder Förderungs-Huihuibums ist. Die Frage ist, was das wert ist: zwar ist es tatsächlich hübsch effektiv, ein Horrorszenario in einem vertrauten Raum wie der Berliner U-Bahn zu sehen, aber davon abgesehen ist Urban Explorer eben wirklich nur Dutzendware, ohne Ecken und Kanten, und dazu noch – wie gesagt – mit einer Story, die völliger Mumpitz ist. Dass man dennoch nicht das Bedürfnis hat, vorzeitig aus dem Saal zu rennen, liegt einmal an der schauspielerischen Leistung von Klaus Stiglmeier und daran, dass Regisseur und Kameramann Fetscher das beste aus dem verunglückten Drehbuch macht und blitzsaubere Arbeit abliefert. Ihm kann man hier so gar keinen Vorwurf machen.
Der Produzent erklärte im Filmgespräch nach der Vorstellung, dass es fünf Jahre gedauert hätte, den Film privat zu finanzieren und in die Kinos zu bringen. Das klingt nach hohem finanziellen Risiko und großen persönlichen Entbehrungen. Sollte Urban Explorer an den Kinokassen zünden und seine Verursacher zu reichen Menschen machen: gut, dann hat sich das gelohnt. Ob er das wird? Ein Film, der halb englisch und halb deutsch gedreht wurde, wird für eine deutsche Kinoauswertung entweder plattsynchronisiert (dann ergeben viele Szenen keinen Sinn mehr) oder untertitelt (dann bleibt das Multiplex-Publikum zuhause). Ob das international anders aussieht, weiß ich natürlich nicht, aber für den hiesigen Kinomarkt sehe ich schwarz. Und wenn Urban Explorer tatsächlich floppen sollte, waren das fünf verdammt lange Jahre, nur um letztendlich einen von zahllosen austauschbaren Horrorschinken in der 18er-Ecke der Videothek gedreht zu haben. The Bad.
Cowboys & Aliens 
 Gerade als ein Rinderbaron und ein Gangsterboss mit Gedächtnisverlust in einer kleinen Stadt im Wilden Westen andeinandergeraten, tauchen Außerirdische auf und entführen Teile der Bevölkerung. Die Kontrahenten brechen gemeinsam zu einer Rettungsaktion auf.
Gerade als ein Rinderbaron und ein Gangsterboss mit Gedächtnisverlust in einer kleinen Stadt im Wilden Westen andeinandergeraten, tauchen Außerirdische auf und entführen Teile der Bevölkerung. Die Kontrahenten brechen gemeinsam zu einer Rettungsaktion auf.
Ein wirklicher Genremix ist Cowboys & Aliens nur an der Oberfläche: Die Essenz des Films ist die Frage, was einen Mann zum Mann macht, ein klassisches Western-Thema. Aus dem Science Fiction entlehnt sind dagegen nur die UFOs, die Laserwaffen und hässliche Weltraummonster, aber kein inhaltliches Element.
Aus der schundigen Prämisse inszeniert Iron Man – Regisseur Jon Favreau einen hübsch unterhaltsamen Blockbuster, der besonders durch sein schlüssiges, bis in die Nebenfiguren gut entwickeltes Drehbuch und das gelungene Produktionsdesign positiv in Erinnerung bleibt. The Good.
Red State 
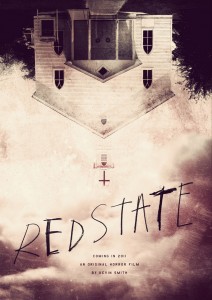 Eine Kleinstadt irgendwo im Nirgendwo der Vereinigten Staaten hat ein Problem an der Backe: am Stadtrand hat sich ein Familienclan religiöser Spinner einquartiert. Die christlichen Fundamentalisten sind zunächst nur lästig – dann aber zeigt sich, wozu sie fähig sind, woraufhin die Situation unaufhaltsam zu eskalieren beginnt.
Eine Kleinstadt irgendwo im Nirgendwo der Vereinigten Staaten hat ein Problem an der Backe: am Stadtrand hat sich ein Familienclan religiöser Spinner einquartiert. Die christlichen Fundamentalisten sind zunächst nur lästig – dann aber zeigt sich, wozu sie fähig sind, woraufhin die Situation unaufhaltsam zu eskalieren beginnt.
Der letzte Kevin-Smith-Film, den ich gesehen habe, war Jay & Silent Bob Strike Back. Das ist etwa zehn Jahre her. Ich war es damals leid, von ihm immer die selben Gags und Selbstfindungs-Geschichten vorgesetzt zu bekommen; war eine Weile schön, aber irgendwann ist’s auch mal gut, und wenn ich seine Filmographie richtig überblicke, ist danach auch nichts wirklich anderes gekommen. Red State hätte ich ohne dessen Festival-Einsatz vermutlich nicht gesehen und damit einen unglaublichen Befreiungsschlag verpasst, den ich dem Mann niemals zugetraut hätte. Der Film hat so gar nichts mehr zu tun mit seinem Oeuvre, wie ich es noch kenne – der hier und da aufblitzende Humor ist nicht mehr nerdig und unterhalb der Gürtellinie, sondern entschlossen grimmig, und Red State ist alles andere als nett, sondern mies und dreckig, abgründig zynisch und nihilistisch, eine Beschreibung der Sexualmoral in den USA, eine wütende Kampfansage gegen christlichen Fundamentalismus und eine Betrachtung darüber, wohin eine solche Konfrontation zwangsläufig führt.
Der Film wechselt nach Belieben die Hauptfigur, zerfällt in drei Teile (die den Themen Sex, Religion und Politik gewidmet sind) und ist offenbar für Kleingeld an einem Wochenende gedreht worden. Nichts davon ist ein Vorwurf. Red State zieht seine Spannung daraus, dass man eben nicht weiß, was als nächstes passiert, dass alles offen ist, dass Look, Kamera und Schnitt sehr direkt wirken. Auch bezieht Smith, der seinerzeit mit Dogma einen sehr versöhnlichen Christenfilm ablieferte, in Red State Stellung und ist eiskalt parteiisch. Kein Wunder: Vorlage für die christlichen Weirdos waren so sympathische Vereine wie die Westboro Baptist Church und die Branch Davidians in Waco, Texas, und entsprechend scheut Smith sich nicht, die Gläubigen des Films als das zu bezeichnen, was sie unzweifelhaft sind: Arschlöcher. The Good.
21. August 2011 (schreib einen) 5 Kommentare
5 Kommentare
2) Lukas
27. August 2011, 16:26
Kommt drauf an, was Du von „C&A“ (Ahem) erwartest: Willste was Visionäres mit Tiefgang, das Du Dir drei mal im Kino anguckst, um hinter alle Details der Story zu steigen? Oder willste einen netten Sommer-Blockbuster, der mal keine kratergroßen Logiklöcher hat und bei dem Du Dich hinterher nicht für dumm verkauft fühlen musst?
Unterhaltsam ist „Cowboys & Aliens“ zweifellos. Der Film hat kaum Leerlauf, es passiert zu viel, als dass er NICHT unterhaltsam sein könnte. Klar ist er keine Komödie, aber nur weil die Prämisse schwachfugig ist, heißt das ja nicht, dass alles in Lustigkeiten untergehen muss.
…ich plane jetzt schon ein Double Feature mit „Red State“ und „End of the Line“.
3) Peroy
27. August 2011, 21:16
„…ich plane jetzt schon ein Double Feature mit “Red State” und “End of the Line”.“
Die Fundi-Scheisse… ? Och näh…
4) Gregor
27. August 2011, 22:04
Ich habe einen unterhaltsamen Sommerblockbuster erwartet und eben das nicht gekriegt, weil Favreau und Co. dem Irrtum auferlegen sind, etwas Visionäres mit Tiefgang zu machen. Bei der Prämisse NICHT auf Lustigkeit zu setzen, ist imho aber die unpassendst mögliche Herangehensweise. Über den Film lachen kann man nicht, weil er sich so verdammt ernst nimmt (immerhin, ab und zu ist er unfreiwillig komisch), aber ernst nehmen kann man den Film nicht, weil, naja, Cowboys und Aliens halt.
Bezüglich Leerlauf und Logiklöcher kann ich dir auch nicht zustimmen. Bremsen die ewigen Dialoge und die vielen Versuche von Charakterisierung den Film nicht über weite Strecken unnötig aus? Dazu die Verzögerungen mit der Bande oder den Indianern. Der Mittelteil zieht sich doch wie nichts Gutes!
Und was Doofheiten angeht: Wieso verteilen sich unsere Helden zur Nachruhe in einem unübersichtlichen Schiff, ohne gescheit Wachen aufzustellen? (Was dann auch entsprechend in die Hose geht, gell.) Toller Zufall, dass unsere Helden im weiten Wilden Westen *ausgerechnet* auf Lonergans ehemalige Bande treffen. Was ist mit der unsäglich albernen Anatomie der Aliens? (Quasi „Independence Day“ in verblödet.) Wieso versucht im Finale keiner, einem der gefallenen Ausserirdischen die Waffe abzunehmen? Wieso tut der Film so, als sei es nicht *jedem einzelnen* Zuschauer sonnenklar, dass Olivia Wilde nicht sterben kann?
Also, ich hab mich durchaus für dumm verkauft gefühlt. Und gelangweilt hab ich mich auch. Ne du, da kommen wir nicht zusammen.
5) Peroy
28. August 2011, 00:43
Du bist dumm. 🙂



1) Gregor
26. August 2011, 23:34
Pfffz, ich wundere mich ja, wo du bei „Cowboys & Aliens“ Unterhaltung und ein gutes Drehbuch gefunden hast. Der Film ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie man einen potentiellen Fun-Film mit zuviel furchtbar ernst gemeintem (aber furchtbar plattem) Charakter-Geseiere an die Wand fährt.
Aber die „Red State“-Kritik versöhnt.